My heart’s in the Highlands, my heart is not here
My heart’s in the Highlands, a-chasing the deer
Chasing the wild deer and following the roe
My heart’s in the Highlands wherever I go
von Tim Wesly Hendrix
Es gibt Orte, die man mehr ins Herz schließt als andere. Die Erwähnung dieser Sehnsuchtsorte füllt einen schon mit Aufregung und dem fast nicht zu bändigenden Verlangen, wieder dort zu sein, wo ein Teil des eigenen Herzens so unwiederbringlich verblieben ist.
Für mich war und ist dies Schottland. Wann und wie diese Liebe begann, kann ich gar nicht sagen. Sie war einfach schon immer da. Während es andere in die Metropolen der Welt, zum Strand oder ins Disneyland zog, wollte ich immer nur nach Schottland. Nach England ging es oft zum Familienbesuch. Dann stand ich auf dieser Insel, freute mich, und doch fehlte mir etwas. Ich habe das heute noch: Wenn wir in England sind, ist dies schön, aber irgendwann richtet sich mein Blick unweigerlich nach Nordwesten, und ich spüre, wie es mich fast innerlich zerreißt vor Sehnsucht nach den Hebriden.

Die jugendliche Sehnsucht stillten Bücher. Da waren die Romanzen von Sir Walter Scott, da war Robert Louis Stevenson, aber vor allem war da John Buchan. Meine Tante hatte mir das erste Buch aus London geschickt. „Da kann der Junge gutes Englisch lernen“, hatte sie meiner Oma noch dazugeschrieben. In Wahrheit versaute mich schon das erste Buch so gründlich, dass mein Englisch zwar gut geworden ist, gleichzeitig meine Weltanschauung aber auch „Buchanisiert“ wurde. Nun gibt es sicherlich schlechtere Vorbilder, selbst wenn weder Buchan noch ich jemals einen Preis für Sozialismus oder Wokeness bekommen werden. Dabei verstand er sich ganz herrlich auf Unsinn. John MacNab ist eines dieser Bücher: Drei Säulen des britischen Staates als Wilddiebe in den Highlands. Das feuerte schon früh meine Fantasie an. Besonders die letzte Schlacht, als in Carn Mor seinen Hirsch erlegte. Sich den ganzen Tag über dem schroffen Klima der Berge aussetzen, durch Matsch und Heide robben, um dann den eigentlichen Herrscher des Glens zu überlisten – was könnte es Schöneres geben?
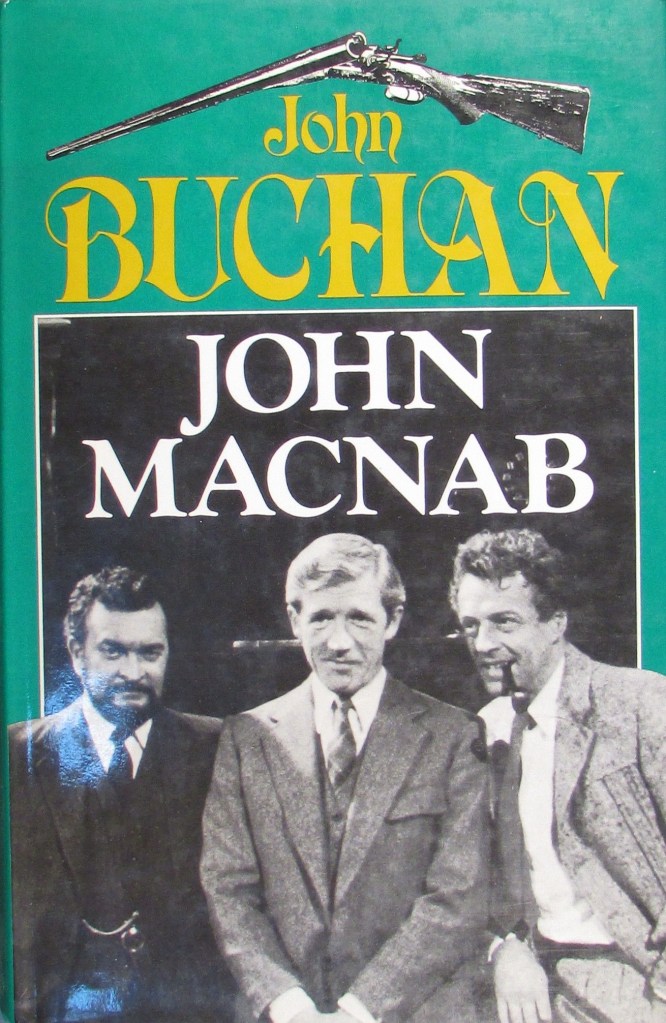
Dieser Traum verblasste nie. Aber zuerst gab es da Probleme pekuniärer Natur, dann kamen Studium, Beruf und Familie dazwischen. Doch zu meinem 40. Geburtstag beschloss ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Meine Frau leistete erstaunlich wenig Widerstand. Wahrscheinlich hörte sie mir einfach erst dann zu, als alles schon gebucht war. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sie meinem genialen Plan der Familien-Jagd-Urlaubs-Kombination zustimmte. Dank dieser temporären Unzurechnungsfähigkeit konnte es also endlich Wirklichkeit werden – dieses Jahr galt es, für die Hirschbrunft in Schottland zu rüsten.
Aber wohin? Skye kam nicht in Frage; mittlerweile ist es nicht nur im Sommer von Touristen überrannt, sondern auch im Herbst. Dazu kommt noch die Tatsache, dass Scott McKenzie schlichtweg auf Jahre im Voraus ausgebucht ist. Warum dann nicht Islay? Wir waren schon mehrfach dort. Die Insel ist wunderschön, der Whisky lecker und gleichzeitig könnte man noch Freunde besuchen, die einen der Welpen meiner Mona haben. Das Ganze könnte als Paradebeispiel für Karma gelten – zuerst bekam eine Freundin den Welpen geschenkt, nun schenkte sie mir eine Empfehlung: Callumkill – hundefreundlich und wunderschön.

Da konnte ich kaum Nein sagen. Schnell war daher die Reise gebucht. Nun galt es aber zu warten. Ein langes Jahr. Ein Jahr, in dem ein prächtiger Rothirsch fiel und in dem ich auch sonst jagdlich einige Höhepunkte erleben durfte. In dem aber immer die Gedanken zur Königin der Hebriden flogen. Denn die Jagd in Schottland war ja doch anders. Die Trophäe gilt hier nicht, sondern das Erleben. Vergleiche ich meinen großen deutschen Hirsch mit seinen schier monströsen Stangen selbst mit dem stärkeren, von mir erlegten schottischen Hirsch, so wirkt er fast wie eine andere Spezies. Ein befreundeter Förster aus der Eifel meinte dementsprechend auch: „So sehen bei uns Hirsche des 5. Kopfes aus.“ Medaillen gewinnt man hier sicherlich nicht, aber darum geht es auch nicht. Denn ehrlicher kann die Jagd nicht sein als beim Wettkampf Mann gegen Tier in der offenen Landschaft der Highlands.
Wie sollte man sich nun auf die Highlands vorbereiten? Fit sollte man schon sein. Also zog ein Rudergerät bei uns ein, auf dem ich mich fortan jeden Tag quälte. Was aber sonst noch wichtig war, das bedurfte einer eingehenden Konsultierung der Hausbibliothek. Wer mich kennt, den wird dies nicht weiter verwundern. Wir reden hier vom eigentlichen Schatz meines Hauses. So fanden sich auch schnell ansprechende Werke. Scropes The Art of Deerstalking (1843) fiel mir als erstes in die Hände. Das war spannend, aber auch ein wenig weit weg vom heutigen Stalking.
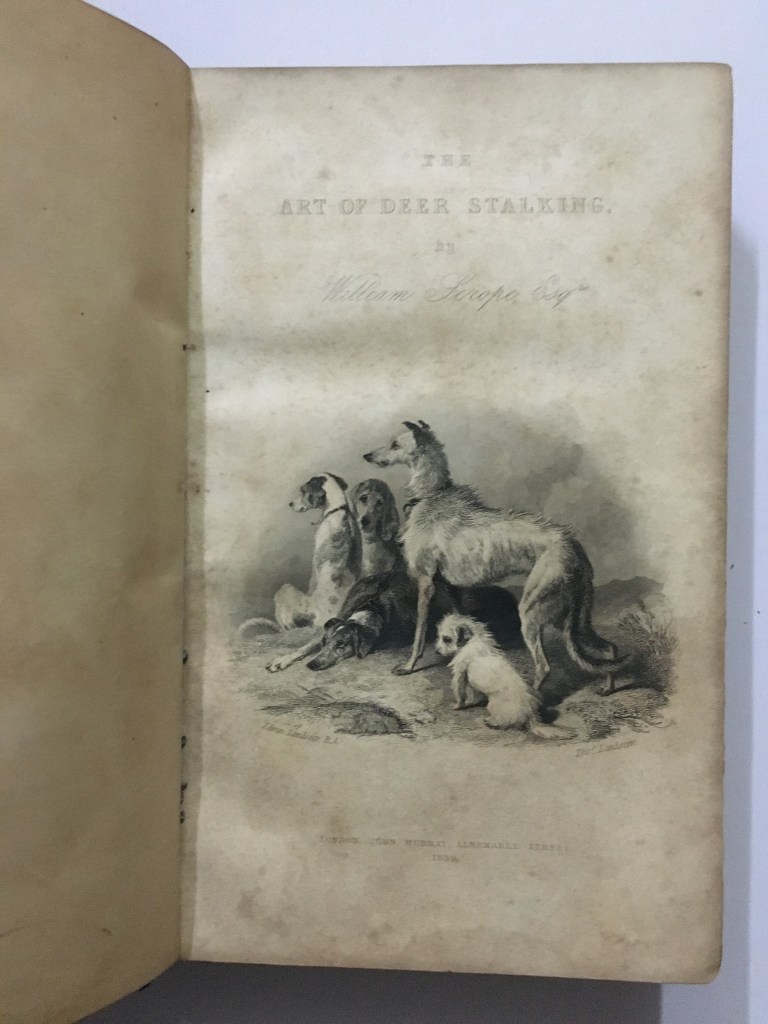
Crealocks Prachtband Deer Stalking (1892) näherte sich wenigstens von der Örtlichkeit schon einmal Islay an, war aber als praktischer Ratgeber für die Jagdausrüstung leider gänzlich unbrauchbar.
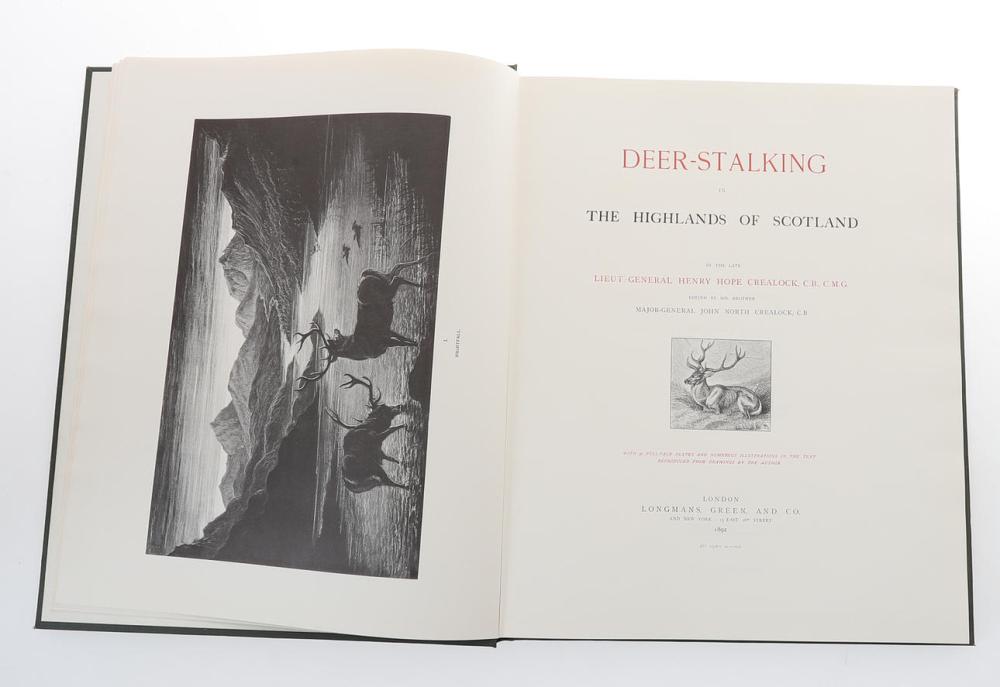
Lays The Deer Forest (1848) brachte immerhin schon die Poesie der Jagd in englischer und gälischer Sprache mit sich.
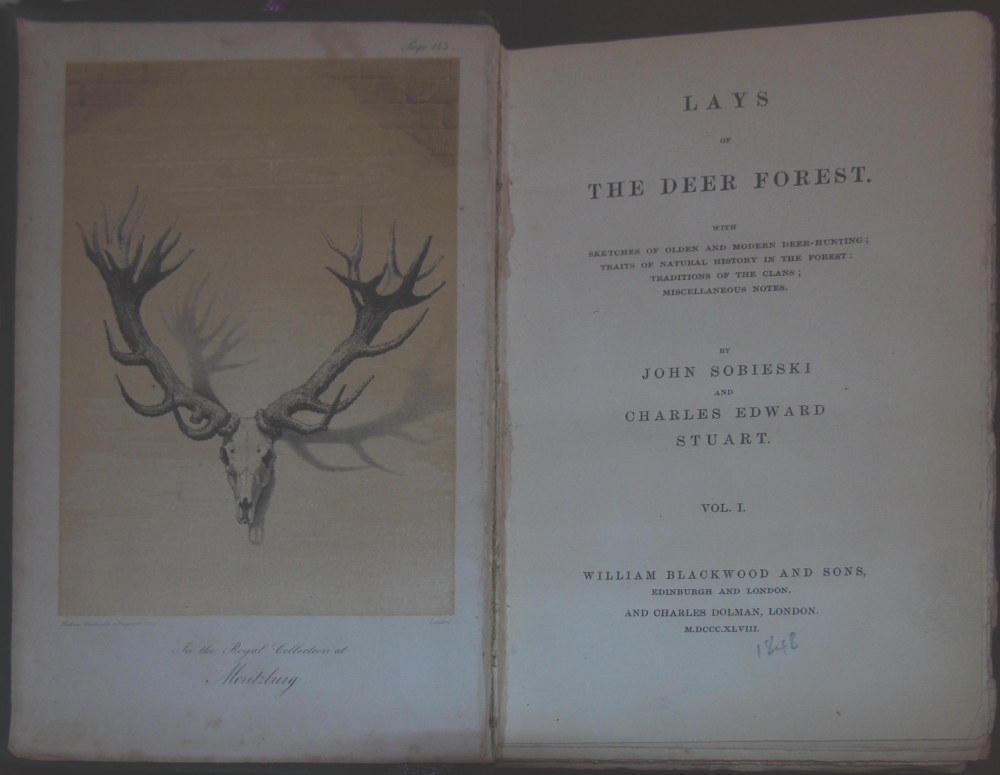
Aber wie Datum und Inhalt bereits vermuten lassen, waren auch die in rotes Leder gebundenen Werke der Sobieski-Brüder wenig dienlich in meinem Unterfangen. Es blieben noch ein paar Werke übrig, aber jedes Mal stellte ich fest: Mit der modernen Ausrüstung hat das Ganze sicherlich nichts zu tun, und moderne Werke gibt es nun einmal noch nicht.
Blieb also das Internet. Dort fanden sich Tausende von Tipps, von denen sicherlich die eine Hälfte gut war, die andere aber reiner Schwachsinn, und mir als Laien die Unterscheidung zwischen beiden schier unmöglich erschien. Ein paar Videos fand ich, und dann kam da eines, das mich innehalten ließ: Hirschjagd auf Islay von der Halali. Was für ein Glück!
Nicht nur war es die gleiche Insel, nein, es war sogar das gleiche Estate und der gleiche Stalker. Das, was ich da sah, ließ mir den Mund offen stehen. Gut, dass das Internet Kommunikationswege vereinfacht – ich fragte also bei der Halali an, und wenig später hatte ich Oliver Dorn am Telefon. Das Resultat: Meine Kleidung würde wohl nicht ausreichen.
Wenige Tage später landete also ein Paket bei mir: ein Smock von Deerhunter und die dazu passenden Breeches. In der Theorie wäre diese Kleidung auch gut gewesen, in der Praxis stellte sich jedoch leider heraus, dass sie zwar wasserdicht, aber auch laut ist. Für eine Treibjagd vielleicht das Richtige, für leises Anpirschen leider nicht.
Dank eines britischen Onlineforums kam dann der nächste Tipp: Nomad-UK-Bekleidung sei das Nonplusultra. Das einzige Problem hierbei: Seitdem der Besitzer der Firma verstorben ist, wird sie nicht mehr offiziell vertrieben. Nach einer Suche konnte ich aber einen kleinen Laden in Ayrshire auftreiben, der noch einen Restbestand dieser zwar sündhaft teuren, aber auch ungemein praktischen Smocks führte. Leider versendet er nicht nach Europa. Aber Freunde von mir haben sich schon daran gewöhnt, dass ich sie als Postlager nutze. Der Blattjagd-Ausflug in die Cotswolds brachte mir also neben zwei Böcken auch noch eine mollig warme Jacke ein. Damit würde man im schroffen schottischen Wetter sicherlich nicht frieren oder nass werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, nahm ich aber auch meine Regenpirschjacke mit. Die könnte man auch so tragen.
Stiefel und Gamaschen gab es. Ja, getragen hatte ich letztere noch nie, aber man hat so etwas ja zu Hause für den Ernstfall. Zur Sicherheit reisten auch direkt drei Stiefelpaare mit – man kann ja nie genug Ausrüstung haben.
Der Pirschstecken, wie ihn jeder in den Highlands nutzt, war etwas Besonderes. Ich hatte ihn drei Jahre zuvor auf der Insel gekauft. Oft in der Hand gehalten, aber noch nie genutzt. Auf dem Haselstecken befindet sich eine Hirschgabel, die mit Horn abgeschlossen ist. Alle Teile dieses Stabes kommen von der Insel und wurden von einem der wahren Meister seines Faches gefertigt. Leider ist er mittlerweile verstorben, und eine echte Nachfolge gibt es noch nicht. Ich habe diesen Stab oft in den Händen und stütze mich auf ihn, wenn die Melancholie mich wieder einmal packt. Fast scheint es, als ob er ein Zauberstab ist, der mich mit Islay verbindet. Besonders nachdem wir jetzt so viel dort erlebt haben.
Ein Stab, Stiefel und Kleidung machen natürlich noch keinen Deerstalker aus. Da fehlen noch die tausend weiteren Dinge, die laut Listen des Field Magazine oder einfach den User-Meinungen in Foren unabdingbar sind für eine gelungene Jagd: Butterbrot, Apfel, Traubenzucker, Schokolade, Flachmann, Zigarre, Pfeife, Messer, Glas, Ersatzhemd … die Listen sind schier unendlich. Man braucht also einen Rucksack. Ich bin eigentlich kein Freund von Rucksäcken. Googelt man das Angebot an Jagdrucksäcken, wird man einfach erschlagen von den unterschiedlichsten Systemen. Gut, da half nur noch einmal nachzufragen, dieses Mal bei Bertram Graf von Quadt. Die Antwort war so genial einfach, dass nur die Jagdausstatter daran Missfallen finden können: „Nutzt die Tasche des Smocks.“ Der Grund war erstaunlich einfach: Ich würde es eh schon schwer genug haben, mein Hinterteil aus der Sichtlinie des Wildes zu lassen. Ein Rucksack sei da nur unnötiger Ballast. Gut, das kam mir gerade recht. Ich habe mittlerweile ja fast nie einen Rucksack dabei. Alles, was man wirklich braucht, kann man in der Regel am Mann tragen. Der ganze Rest ist dann nette Spielerei, aber für die Jagd nicht wirklich notwendig.
Die nächste Frage war dann schon schwerer zu beantworten: Bringe ich meine eigene Waffe mit oder verlasse ich mich darauf, dass die Estate-Waffe nicht über eine Fixierung der Zieloptik mit Klebeband verfügt? Dagegen sprach der lange Weg, der Stopp in England auf dem Rückweg und natürlich auch ein wenig das Prozedere an der Grenze. Hätte ich damals schon meine kleine, feine Kipplaufbüchse gehabt, ich hätte nicht nachdenken müssen. Ich habe sie so sehr ins Herz geschlossen, dass ich am liebsten keine andere Waffe mehr schießen mag, und dies war dann auch ein kleiner Wermutstropfen. Es ist schon eigenartig, wie objektofil man werden kann. Ich ertappte mich immer wieder bei der Jagd dabei, die Merkel zu vermissen. Statt meiner vertrauten Lady würde aber eine fremde Waffe auf mich warten.
Die Tage verstrichen also. Gerüstet war ich, und ich zählte die Monate, Wochen und Tage herunter. Gut, dass einer meiner amerikanischen Cousins noch die letzten Tage vor unserer Abreise sich für einen Kurzbesuch angemeldet hatte. Ich wäre sonst vor Vorfreude zersprungen. Nun gut, es stellte sich heraus, dass dies ein zweischneidiges Schwert war. Natürlich lenkte mich sein Besuch ab, aber dann gibt es da leider die üblichen Rituale zu beachten: Tabak und Whisky, dazu lange Gespräche über das Leben, Politik und Geschichte. Selten geht es dann vor zwei ins Bett. Mein Opa pflegte zu sagen, jeder habe eine bestimmte Anzahl an Tagen, die er vom Kater verschont bleibt. Dieses Kontingent habe ich aber leider schon vor etlichen Jahren ausgereizt, und so wird es morgens dann doch ein wenig schwer aufzustehen. Dank zweier kleiner Kinder bleibt mir aber nichts anderes übrig, und so dümpeln solche Tage ein wenig vor sich hin, bevor dann die Erlösung in Form des Kinder- oder halt Vater-ins-Bett-Bringens kommt.
Mit dieser Komplikation hatte ich natürlich in meiner Urlaubsplanung nicht gerechnet. Der Freitagnachmittag kam daher: Mein Cousin wurde am Bahnhof abgeladen, und wir fuhren los. Meine Frau bezeichnet meine Pläne meistens als „irre“. Ich kümmere mich nicht weiter drum, und im Endeffekt funktioniert es dann auch meist ohne größere Probleme. Meistens. Dieses Mal befand die Oberste Heeresleitung, man müsse doch das Haus in einem akzeptablen Zustand hinterlassen. Man stelle sich mal vor, da bräche einer ein und würde Staub vorfinden. Gar nicht auszudenken, was der dann für eine schlechte Meinung von uns hätte. Es wurde also gesaugt und geputzt, bis ein für meine Frau erträgliches Maß an Ordnung hergestellt war. Erst dann rollte der VW-Bus langsam Richtung Calais. Wie langsam das sein würde, hatte ich nicht gedacht. Im Sinne der neuen EU-Umweltreform haben die Belgier scheinbar eine neue Art des Emissionsschutzes entwickelt: Ohne ersichtlichen Grund wird der Verkehr auf 20 Stundenkilometer gedrosselt. So konnten wir dann langsam und äußerst unentspannt durch die Heimat der Pommes rollen. Machen ließ sich nichts. Ärgerlich war es dennoch. Mein Plan, entspannt als Beifahrer den ersten Teil zu verbringen, scheiterte somit glorios, und als wir mit mehr als einer Stunde Verspätung endlich auf den Waggon rollten, war ich weder erholt noch entspannt. Gut, dass nur noch knappe tausend Kilometer Wegstrecke vor uns lagen.
Immerhin hatte ein nicht unwichtiger Aspekt meines Plans funktioniert – die Kinder schliefen. Normalerweise würde ich also frohen Mutes aus dem Terminal fahren in der Hoffnung, vor den ersten Sonnenstrahlen den Moloch London hinter mir gelassen zu haben. Normalerweise scheint dann aber auch spätestens ab Milton Keynes der erste Schimmer der Morgensonne. Jetzt legte sich die Nacht finster über die ohnehin nicht sonderlich gut ausgebauten Straßen. Im Dunkeln über düstere Autobahnen, die eigentlich bessere Landstraßen sind, zu fahren, war dann doch eine Herausforderung. Zum Glück erwachte meine Frau nach ein paar Stunden aus ihrem wohlverdienten Schlaf und übernahm die Strecke bis Scotch Corner. Von dort an wendete sich das Blatt. Es war zwar noch dunkel, aber wir waren im Land der Lowthers. Lowther Castle, muss man dazu sagen, war Gegenstand meiner Masterarbeit. Damit war die Gegend mir nicht mehr anonym und fremd, sondern ich konnte die finsteren Fetzen mit Geschichten füllen, und zudem bedeutete dies, dass jeder Kilometer uns der Grenze näher bringen würde. Die ersten Sonnenstrahlen legten sich kurz hinter Penrith über die rollenden Hügel des Nordens.

Ich liebe diesen Teil der Fahrt. Vergessen sind die großen Ballungszentren mit den Überresten der industriellen Revolution. Weite Täler, Moorlandschaft, Heide – und dann ein Schild: Failte gu Alba.

Gretna Green Services, immer mein erster und letzter Stopp auf jeder Reise, lag nur eine Meile weiter. Rast, Kaffee, endlich in Schottland. Gretna Green wird dem einen oder anderen auch heute noch etwas sagen. Bekannt war es einst für seine doch etwas lockeren Hochzeitsarrangements, sodass viele Paare sich hier trauen ließen, bevor ihre Eltern und Familien einen Schlussstrich unter die Romanze ziehen konnten. Ein Cousin meines Opas hatte dies direkt nach dem Krieg so gemacht, und seine Ehe hielt bis zum Tod. Heute ist davon natürlich nichts mehr übrig. Stattdessen ist das Dorf zu einer Art Brigadoon geworden. Tauglich höchstens als Hollywood-Kitsch-Kulisse. Möchte man diese Gegend besuchen, sollte man lieber weiter nach Annandale fahren. Das ist ebenso schön und weitaus weniger überlaufen.
Stoppen wollte ich aber nicht zu lange. Denn eine Fähre wartete ja noch auf uns, und der Weg dorthin war noch weit.
Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, welchen Effekt dieses Ankommen in Schottland hat. Die rituelle Überschreitung der Grenze wirkt wie ein Jungbrunnen auf meine von der Reise geschundenen Geister. Und mit jedem Kilometer, den ich der Highland Line, also jener imaginären Linie, die Highlands und Lowlands voneinander scheidet, näher komme, desto mehr erwachen meine Lebensgeister.
Zunächst führt der Weg dann durch die Lowlands. Hier hört man die Stimme Sir Walter Scotts erzählen: Geschichten von Elliots und Armstrongs, beides Clans, die ihren Lebensunterhalt als gesetzlose Plünderer verdienten und mit ihren Beutezügen in die Poesie und Legenden dieser Gegend für immer einzogen.
Hinter Glasgow beginnen allmählich die Highlands.
By the bonnie banks of Loch Lomond – ein wahrer Klassiker der schottischen Folklore, in dem es wieder einmal darum geht, dass die Engländer leider gewonnen haben und einen der beiden Soldaten dafür den Kopf von seinen Schultern trennen wollen. Dieser singt nun, dass er den low road nehmen wird und damit schneller zu Hause ist als der Überlebende. Nützen tut ihm dies nicht. Weder seine Geliebte noch seine geliebten Berge, Täler und Seen wird er wiedersehen. So mischt sich auch bei mir immer ein wenig Melancholie ins Gemüt, wenn ich sehe, wie dieser einst als Sublime gefeierte See mittlerweile ein Naherholungszentrum der nahegelegenen Metropole geworden ist.
Hinter wird es dann wilder. Die rauen Täler ziehen sich westwärts, und hat man den Rest-and-be-Thankful Pass überwunden, mache ich immer ein Stoßgebet zum Herren. Meine Frau versteht das nicht. Aber ich habe ihr auch noch nie erzählt, wie oft hier die Straße unter einer Lawine aus Schlamm und Stein verschwindet. Ein Tunnel wäre sicher eine gute Lösung. Für den Staat ist er aber zu teuer, und nehmen würde ich ihn dann auch ungern. Es würde den Genuss der Landschaft doch erheblich trüben.

An der Küste geht es nun zunächst Richtung Ardkinglas – hier hatte sich eine englische Industriellenfamilie einen Landsitz errichten lassen. Die Tochter des Hauses heiratete nie und widmete ihr ganzes Leben der Zucht von Deerhounds. Vor ein paar Jahren hielten wir dementsprechend auch hier für ein Foto und wurden direkt vom Neffen der Dame ins Haus gebeten. Seine Kinder hätten noch nie einen Deerhound gesehen, ob wir nicht zum Tee bleiben wollten. Der Schotte an sich, aber besonders die Schotten der Western Highlands and Islands, sind so gastfreundlich, dass eine Absage den guten Mann tödlich gekränkt hätte, und so verbrachten wir einen schönen Nachmittag dort.
Dieses Mal war keine Zeit für einen Halt. Weiter ging es durch Inveraray. Ein schönes kleines Touristenstädtchen, zudem der Stammsitz des Earl of Argyll, der aber ein Campbell ist und daher eigentlich zu den „Bösen“ gehört. „Traue niemals einem Campbell“ ist ein geflügeltes Wort in Schottland. Manche sagen, dies sei so, weil die Campbells als Hochland-Clan dennoch für William of Orange und später die dicken Georges kämpften; andere hingegen sagen, dass bereits der Stammvater dieses Clans Dermaid seinen König Fingal betrogen habe. Man merke also: Die Schotten des Hochlands sind nicht nur gastfreundlich, sondern haben auch ein sehr langes Gedächtnis.
„Wir sind doch gut in der Zeit, Schatz“ – dieser Satz riss mich leider dermaßen aus den Träumen, dass ich ihn ehrlich beantwortete. Man kennt das: Ein Partner denkt immer an die ausgeklügeltsten Grausamkeiten, um den anderen in den Wahnsinn zu treiben. Meine Frau kann es zum Beispiel nicht ertragen, auch nur eine Minute zu früh anzukommen. Daher antworte ich in der Regel im Negativ: Schatz, wir sind viel zu spät dran. Meine positive Antwort führte dann auch direkt zum Zwangsstopp am Supermarkt – auf der Insel sei ja alles teurer. Was nicht stimmt. Eine gefühlte Ewigkeit später kam Laura dann auch wieder aus dem Supermarkt mit einem Sammelsurium an Dingen, die wir nicht wirklich brauchen konnten. Es müssen Eichhörnchen-Gene im Stammbaum meiner Frau sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Puffer hatten wir jetzt nicht mehr wirklich. Als wir dann endlich an der Fähre ankamen, waren die einzelnen Schlangen schon gut gefüllt. Normalerweise kein Grund zur Sorge, man hat seinen Platz. Dass der Mann beim Einchecken suchte, war auch noch nicht weiter verwunderlich. Dann aber die Hiobsbotschaft: Das System hatte zwar meine Frau und mich (2 adults), meine beiden Kinder (2 children) und meine beiden Hunde im Auto (2 dogs in car), aber nicht das Auto gebucht. Meine Frage, wie ich denn die Hunde im Auto mitnehmen solle, wenn ich doch gar kein Auto gebucht hätte, konnte mir die Dame dann leider auch nicht hinreichend erklären, und wir einigten uns darauf, alle Schuld der Technik zuzuschreiben. Weder für die Hin- noch für die Rückfahrt hätten wir damit einen Platz, und ausgebucht sei die Fähre auch bis nächsten Donnerstag. Die Rückreise sei aber immerhin am Sonntag anstatt Samstag möglich. Nach fast 24 Stunden ist das nicht, was man hören möchte. Letzte Hoffnung: Standby lane. Gut, da standen aber schon sieben Autos vor uns. Langsam bewegten sich dann die Wagen einer nach dem anderen auf die Fähre. Sogar der Wagen hinter uns in der Schlange durfte drauf fahren. Geistig überlegte ich schon, wie auch immer ich irgendwo in der Gegend ein Zimmer für die Nacht finden sollte. „Don’t be so pessimistic“, lachte mich der Ferrymaster an. Wir rollten auf die Rampe. Da war aber alles voll. Niemals würden wir draufpassen. Das war’s, dachte ich noch. Aber es passte. Das Hinterrad stand noch auf der Fähre. Das Heck guckte freilich in den Sperrbereich. Die Rampe nur wenige Zentimeter entfernt von der Heckklappe. Aber wir waren an Bord.

Jetzt war mir alles egal. Meine Frau wurde noch schnell mit den Kindern im Restaurant abgesetzt, dann zog es mich magisch auf Deck. Die Pfeife glühte auf, der Wind der Hebriden strich mir sanft übers Gesicht, und die Sonne wärmte die von der Reise geschundene Seele.

*
Dr. Tim Wesly Hendrix

Tims Frau beschreibt ihn so: „Der ist einfach ein wenig verrückt“ würde sie sagen. Nun liegt das Genie nah am Irrsinn, er nimmt das also als Kompliment.
Aus dem Bergischen kommend zog es ihn in die weite Welt zum Studium – also nicht ganz so weit weg vielleicht – nach Köln. Mit Zwischenstation in Edinburgh beurteilte ihn dann eine Reihe von Professoren als soweit gereift, um ihm den Doktortitel im Fach Kunstgeschichte zu verleihen. Man möge es ihnen verzeihen. Nebenbei gab es dann noch einen Master in Anglophone Literature – was wiederum nichts anderes ist als das schnöde Anglistik Studium vergangener Tage.
Man sieht also, Tim ist den britischen Inseln und der englischen Sprache sehr zu getan. Seine Frau fragt ihn schon nicht mehr, wo der Jahresurlaub seiner Meinung nach hingehen soll, die Antwort ist ihr hinreichend bekannt. Schottland mit seiner raue, poetischen Westküste hat ihn so in den Bann gezogen, dass er dort jeden Urlaub verbringen könnte.
Das heißt nicht, dass er die anderen Länder nicht wertschätzt – aber keines, nicht einmal die berühmten Wasser Afrikas – haben ihn so vollkommen einnehmen können.
Das spiegelt sich auch in der Leidenschaft für Whisky nieder, obwohl er einem guten Wein auch nicht abgeneigt ist. Kommt dann noch eine Zigarre, oder eine seiner geliebten Pfeifen dazu – das ist wahrer Es(s)kapismus für ihn.
Früh schon zog es ihn ans Wasser, um den heimischen Forellen in kleinen Bergbächen nachzustellen und auch heute noch schwingt er gelegentlich seine Fliegenrute. Was gibt es auch schöneres, als bei ausreichend Wind an einem Bach auf einer Hebrideninsel zu stehen und Fliegen aus der Vegetation zu befreien?
Das seine Hardy Ruten nur noch gelegentlich genutzt werden, liegt vor allem an seiner wohl größten Passion: Der Jagd.
Sie war immer irgendwie da. Schon als kleiner Junge vor der beeindruckenden Wand seines Großonkels. So richtig hat er aber erst vor relativ kurzer Zeit zu ihr gefunden. Dies konnte er freilich durch Eifer, seine Frau spricht von manischem Zwang, ausgleichen.
***


Von KRAUTJUNKER gibt es eine Facebook-Gruppe sowie Porzellantassen. Weitere Informationen hier. Die Hemingway-Buchstütze findet Ihr hier.
Entdecke mehr von KRAUTJUNKER
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.