Buchvorstellung von Anja Nixdorf-Munkwitz
Der Zauber einer Zutat
Kochbücher können vieles sein, banale Bauanleitungen für Gerichte, Geschichtensammlungen aus exotischen Landschaften, Kulturgeschichte auf dem Teller oder ein Labyrinth aus Anekdoten. Wie alle Texte und Textsammlungen schwingt ihn ihnen auch eine gewisse Temperatur, eine Art persönliche Note der oder des Schreibenden mit. In einer Zeit der Kochbuchflut haben wir uns daran gewöhnt, mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Werke heranzutreten. Sie sollen uns auf die eine oder andere Art unterhalten. Sie sollen gefällig sein. Vor allem aber sollen sie sich uns leicht erschließen. Die Küche der Armen bricht mit den Erwartungshaltungen. Die Autorin Huguette Couffignal ist nicht leicht zu erfassen, geschweige denn zu fassen. Die Sammlung von Rezepten wird mit einer eigenartigen Mischung aus kühler Sachlichkeit und warmem Gefühl aufbereitet. Knappe Erläuterungen zum Kern des Buches rahmen die in Blöcken zusammengestellten Abschnitte über Suppen, essbare Pflanzen und Gemüse oder Fleisch, Fisch und Käse. Was aber serviert uns das Werk als den Kern? Die einfache und fast vergessene Tatsache, dass wir essen, um zu leben.
Wie jede wirklich große Wahrheit klingt auch der Satz »wir essen um zu leben« wie ein sehr banaler Sinnspruch. Und ebenso wie jede andere Wahrheit braucht es fast eine Meditation über die Textzeile, um sich die Tiefe der darin erschlossenen Welt anzueignen. Die Fallhöhe, aus der wir in das Buch Die Küche der Armen eintauchen, ist enorm. Wir essen heute aus vielerlei Gründen, Hunger ist bei genauerer Betrachtung nur in der Minderzahl unserer »Verzehr-Situationen« der Anlass unserer Nahrungsaufnahme. Wir essen aus Langeweile, um uns zu trösten, wir essen aus Appetit, aus Geselligkeit, weil die Zeit für die nächste Mahlzeit genommen ist oder schlicht und einfach, weil das Essen eben da ist. Deswegen tun sich Ernährungsforscher so schwer, in den Analysen über unser Verzehrverhalten in der sogenannten ersten Welt noch von Mahlzeiten zu sprechen und haben den Verlegenheitsterminus »Verzehr-Situationen« erfunden. Wirklich nötig sind die wenigsten dieser Mahlzeiten oder Snacks für uns, denn wir leben in einem ungeheuren Luxus, verglichen mit den »Armen« über die Huguette Couffignal schreibt. Diese Zeiten, die 1960er und 1970er Jahre, die aus dem Buch heraufscheinen, sind scheinbar ungeheuer weit weg und für uns kaum erfassbar. Mit der Einfachheit des Textes und der Klarheit der Bilder aus aller Welt wird die Tatsache immer wieder vor unsere Augen gestellt »wir essen um zu leben«. Wir Menschen essen – eigentlich – um zu leben, zu überleben. Für zahllose Menschen war und ist es nicht klar, dass es genug für die nächste Mahlzeit, den heutigen Tag oder gar das Morgen geben wird. Die Armen können nicht wählen, sie verzehren, was ihnen zugänglich ist. Auch für die Leser in Frankreich muss dieser Bruch mit der eigenen Lebensrealität schon ein Schock gewesen sein, als das Buch erstmals erschien.
Armut wird nicht verklärt, nicht mystifiziert und nicht zu einer Weisheit stilisiert, nach der wir uns aus der wohligen Geborgenheit des Überflusses zurücksehnen können. Die Küche der Armen ist weit weg von der Sozialromantik einer wiederzuentdeckenden Weisheit des Ursprungs. Arm zu sein bedeutet, um sein Überleben kämpfen zu müssen. Jede Region der Welt und jede Zeit hat verschiedene Formen der Armut aufzuweisen, und jede dieser Formen drückt sich in der Art aus, Nahrung zu finden, zuzubereiten und zu verzehren. Satt werden und doch auch ein wenig Raffinement in den Alltag bringen, wenig Geld ausgeben und doch für die Familie genug zu haben, aus der Natur nehmen und mit wenig ein Ganzes schaffen – das sind die „Zutaten“ der Rezepte. Wir Lesenden sind hier nicht aufgefordert, auszuwählen was wir nachkochen wollen, wir sitzen nicht automatisch mit dem Notizblock bei der Lektüre, um den Speisezettel der Woche zusammen zu stellen. Wir sollen nicht staunen, wir werden nicht mit amüsanten Anekdoten unterhalten oder mit inszenierten Arrangements zum Träumen gebracht. Wir lesen Seite für Seite eine uralte Wahrheit »wir Menschen essen um zu leben und das ist oft schwer«.
Vom Finden und Erfinden der Lebensmittel
Landschaft ist essbar, jede Landschaft ist essbar. Arme Menschen leben eher von dem, was die unmittelbare Umgebung ihnen zur Verfügung stellt. Zumindest ist es der Autorin gelungen, in der Zeit, die sie abbildet, diese Botschaft noch genau darstellen zu können. Palmen und Queller, Hirse und Buchweizen, Hammelfleisch und Yakmilch, Heuschrecken und Wasserkastanien – die Rezepte verbinden häufig einige wenige Zutaten in leicht abgewandelten Kombinationen immer wieder zu verschiedenen Gerichten. Dabei entstehen Landschaftsbilder der Kulinarik, die für Osteuropa oder Südostasien, für Mexiko oder den Mittelmehrraum jeweils charakteristisch sind. Beim Lesen fragen wir uns automatisch, ob die Globalisierung diese Strukturen schon grundlegend geändert hat. Essen armen Menschen heute anders, weil die Warenströme rund um den Globus die Gefüge bereits grundlegend geändert haben? Geändert haben wird sich für Viele nicht das Grundlegende. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, der gibt überproportional viel seines verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus. Genutzt wird, was verfügbar ist, Ausgewogenheit und Frische, Geschmack und Vielfalt sind häufig gar nicht als Kriterien denkbar. Oder ist dieser Blick zu oberflächlich? Liest man das Buch mit frischem Blick ein zweites Mal, fallen kleine und erstaunliche Details auf. Wann war es in Deutschland denn generell üblich, aus Blüten Mahlzeiten zuzubereiten? Scheinbar gibt es in jeder kulinarischen Tradition kleine gefüllte Klößchen aus Teig. So wie der Teig aus verschiedenen Getreidesorten oder Kartoffeln zu bereitet werden kann, so variieren auch die Füllungen. Doch rund um den Globus sind sie in aller Munde, diese Ravioli, Maultaschen, Piroggen oder Empanadas. Was ist eine „normale Zutat“? Wir essen Schwein oder Rind und empfinden das als vollkommen normal. (Wenn wir uns nicht für eine vegetarische oder vegane Ernährung entschieden haben). Aber bei dem Gedanken an Robbenfleisch oder im Lehm gebackenen Igel kommen wir ins Grübeln. Warum erscheint es unnatürlich oder zumindest befremdlich, das Fleisch dieser Tiere zu verzehren? Normal ist eben, was der jeweiligen Norm entspricht. Gürteltier oder Elefant können wir uns einfach nicht wirklich als Eiweißquelle vorstellen, aber Straußenfleisch haben manche durchaus schon mir Genuss verzehrt. Wo also ist der Unterschied? Wer setzt die Normen und hat Armut jemals die Wahl?
Der Stellenwert der Lebensmittel, ihr Anbau, ihre Verarbeitung und die Zubereitung scheinen in einem Maße Bestandteil der Alltagskultur gewesen zu sein, wie wir es heute kaum noch aus unserem Umfeld kennen. Die Autorin Huguette Couffignal zeigt auf subtile Art und Weise, wie groß der Raum für das ist, was man nicht hat oder wenig hat oder um das man sich sorgen muss – das tägliche Essen – wenn man wirklich arm ist. Ihr Schilderung bezieht sich zumeist auf Zutaten, relativ unverarbeitete Produkte, aus denen dann relativ einfache Gerichte selbst zubereitet werden. Mehl oder Getreide, Gemüse und Früchte, Fleisch oder Fleischreste und Knochen verschiedener Tiere werden gekauft, teilweise der Anbau, die Aufzucht und Schlachtung noch beschrieben. Das Essen ist viel näher, ursprünglicher, als man es heute aus dem eigenen Lebensumfeld kennt. Uns erscheint es schon als besondere Qualität, uns überhaupt für unverarbeitete Lebensmittel zu entscheiden. Interessante Fragen tauchen auf, die man gern auch in Ansätzen beantwortet bekommen hätte. Etwa fragt man sich, ob auch heute noch Ursprungsprodukte diesen hohen Stellenwert haben, oder ob in der ganzen Welt die Ernährung von armem Menschen vielleicht in großem Maße von vorverarbeiteter, günstiger Industrieware abhängt. Da das Buch hier keine Aktualisierungen vornimmt, sondern nur in seltenen Fällen Statistiken mit aktuellen Werten angibt, ist eine schlüssige Entscheidung. So bleibt dem Lesenden aber der Schritt zur eigenen Recherche überlassen, diesen Schritt möchte man jedoch unbedingt empfehlen.
Erdöfen, Feuerstellen, Töpfe und Pfannen, Holzkohlegrill und Räucherofen sind einfache und uralte Zubereitungsmetoden, in denen die Gerichte entstehen. Getreide und Pflanzen liefern die Basis, Insekten und Fleisch wird ebenso gern mit verwendet wie Milch oder Käse, sofern man diese Zutaten bekommen kann. Mit großer Selbstverständlichkeit wird gekocht und verzehrt, was man kaufen, anbauen oder sammeln kann. Alkohol und Süßes wird überall gern genossen. Man kann nicht wählerisch sein und man muss flexibel bleiben. Um leben und überleben zu können, muss man essen. Wenn möglich, soll dieses Essen schmackhaft und reichlich ausfallen. Immer droht die Gefahr, dass die nächste Mahlzeit ausfällt, dass Hunger die nächsten Tage bestimmt. Wir wissen, dass diese Realität sich nicht geändert hat. Auch die Gewinnung der Nahrung durch wenig nachhaltigen Anbau, ja Raubbau an der Natur, ist nicht abgeschafft, sondern wird häufig weiter mit einfachen Mittel betrieben. Man hat wenig Wahlmöglichkeiten, wenn man arm ist. Die Kulturgeschichte der Kulinarik der Armen, welche Huguette Couffignal mit bewundernswerter Ruhe und Zurückhaltung in einem Moment darstellt, in einer Umbruchzeit des zwanzigsten Jahrhunderts, verdient weitergeführt zu werden.
Die Küche der Armen ist kein Kochbuch, auch wenn es eine Sammlung von Rezepten beinhaltet. Es ist eine Annährung an das Phänomen der Armut und der gelungene Versuch einer Darstellung vom Kosmos des „arm seins“ als existenzielle Herausforderung. Zugleich ist Huguette Couffignal ein Porträt ihrer Zeit und deren Bick auf die Welt gelungen. Man liest sich fest, man legt es weg, man greift erneut zum Buch. Sich lesend der Welt nähern, indem man den Abstand zwischen sich und anderen ermessen lernt und die Nähe, die uns doch über jede Kluft hinweg verbindet, dieses Kunststück ist der Schreiberin, Reisenden, Erklärerin gelungen. Sie aber, die Autorin, bleibt vollständig hinter ihrem Weg verborgen. Kein Bild, keine Biografie, keine Details ihres Lebens lenken den Blick weg vom kargen Text und seinem nicht minder kargen Gegenstand, der „Küche der Armen“. Was die Lektüre schenkt ist die Frage, welches Verhältnis wir zu unserer Ernährung haben und inwiefern wir weiter über die Ziele hinausgelangt sein könnten, ob wir uns erden sollten, wieder dankbar dafür zu sein, uns sattessen zu können, aus den Lebensmitteln wählen zu können.
Ganz persönlich folgt mir nach dem Zuklappen der Seite ein Nachklang von Demut vor der Fülle des Essbaren. Mehr als bisher schon ist es mein Ziel, zu schätzen, was ich habe und zu verwenden, was mir gegeben wird. Mitten in einer reichen und köstlichen Landschaft zu leben, schafft die Freude, sich vielfältig und abwechslungsreich mit dem Besten der Natur und der Kultur versorgen zu können. Dies ist bei weitem nicht selbstverständlich, auch wenn wir das leicht vergessen. Die Lust am Essen nehme ich mit und die Wertschätzung des Hungers, den wir fast vergessen haben, und der jedes Gericht köstlicher macht.
*
Pressestimmen
Von A wie Alge bis Z wie Zito, wie ein serbischer heiliger Kuchen heißt: Man entdeckt schlichte Gerichte, von denen man nie gehört hat und die einem manchmal sogar das Wasser im Mund zusammen laufen lassen. Zum Glück haben die Herausgeber diese Neuauflage kommentiert und mit aktualisierten Angaben ergänzt.
-Katrin Krämer, Bremen Zwei
In den Rezepten dieses Buchs beginnt man nach Ideen zu suchen, mit schlechtem Gewissen, weil man sie sich in aller Sattheit aneignet. So sehr entspricht zumindest der vegetarische Teil dem Alltag unserer Konsumgesellschaft. Die Igel, Elefanten und Eidechsen, von deren Zubereitung Couffignal weiß, liegen ferner. Fußnoten der Herausgeber zeigen, welche Entwicklung es im vergangenen halben Jahrhundert gab. Die Autorin hatte aber in den Siebzigerjahren schon einen scharfen Blick für die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Sie rechnet vor, ›was die Erzeugung einer tierischen Kalorie im Vergleich zur Erzeugung einer pflanzlichen Kalorie kostet. Milch zum Beispiel bringt nur 15 Prozent der verbrauchten Energie wieder ein, Eier 7 Prozent, das Rindfleisch höchstens 4 Prozent‹.«
-Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung
Couffignals Kochbuch ist die perfekte Antithese zu heutigen Hochglanzkochbüchern, bei denen alles instagrammy angerichtet ist und der Verweise auf den Ursprung eines Gerichts als ›traditionelles Armengericht‹ vor allem dazu dient, dem Ganzen den Glanz der Authentizität zu verleihen. In der Küche wird die Armut oft romantisiert: da werden Gerichte dann mit Bezeichnungen wie ›herrlich simpel‹ belegt oder die Einfachheit der Zutaten betont. Die Armutsromantik, mit der die Rede vom ›traditionellen Armengericht‹ verbunden ist, hat bei Couffignal keinen Platz. Sie kehrt in ihrem Buch dagegen heraus, worum es in der Küche der Armen eigentlich geht: ums Überleben. Und sie arbeitet heraus, was wir aus der Küche der Armen lernen können – oder besser, lernen müssen: Nachhaltigkeit. Dass Couffignal das vor 50 Jahren schon erkannt hat, in einer Zeit, in der die wenigsten Menschen sich über ihren Konsum Gedanken gemacht haben, ist bemerkenswert hellsichtig.
-Kais Harrabi, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die Küche der Armen ist eine für den Hausgebrauch teils nützliche Rezeptsammlung sowie ein ethnologischer Essay, der die Beobachtungen seziert, die Couffignal auf ihren Reisen über alle Kontinente zusammengetragen hat. […] In einem ist Couffignal auch heute noch ihrer Zeit voraus: Ihr Plädoyer für den Verzehr von Insekten, darunter Heuschrecken, Termiten, Raupen, Larven und Würmer, lässt wohl nur wenigen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dabei, weiß die Autorin, gelten die bei uns mit Ekel behafteten Vielbeiner nicht nur in anderen Ländern als Leckerbissen; sie gehörten allein schon aus Vernunftgründen auf den Teller. […] Wer immer sie auch sein mag, Huguette Couffignal schreibt so ungerührt und lakonisch über Irres, dass gerade die unrealistischen Rezeptideen [Elefant] der Lektüre lohnen.
-Ronald Düker, Die ZEIT
Was man nicht weiß: Was essen die Armen? Wie bereiten sie sich den Reis aus den Säcken der United Nations zu oder das Mehl aus der Ukraine, um die momentan mit Waffengewalt gestritten wird? Das Buch ›Die Küche der Armen‹ leuchtet diese kulinarische Dunkelzone aus. Es ist, das macht es trotz dem ernsten Unterton des Themas zu einer so interessanten wie vergnüglichen Lektüre, nicht vordergründig aus politischem Interesse geschrieben, sondern aus kulinarischem. Es geht nicht darum, warum manche Menschen arm sind, sondern um die Frage, wovon sie sich ernähren. Vor allem halt, wie sie das wenige, dessen sie habhaft werden können, zubereiten. Und ja: Die Rezepte dieser Cuccina povera sind beigefügt. […] Spoiler: Wenn gar nichts anderes aufzutreiben ist, wurde mancherorts tatsächlich Erde zubereitet. […] Dass sich aber auch aus wenig, aus stärkehaltigem und satt machenden Zutaten interessante Gerichte zubereiten lassen, das wissen vor allem noch die Zeitzeugen der Nackriegszeiten. Die aber werden weniger und weniger. Von daher ist dieses weltweite Notwissen hier bestens aufbewahrt: in einem schönen Buch.
-Joachim Bessing, Neue Zürcher Zeitung
*
Anja Nixdorf-Munkwitz

Bei der Arbeit oder in der Küche – lautet der Status bei WhatsApp und das meint die Industriekulturfachfrau und Regionalmanagerin durchaus wörtlich. „Lausitz ist einfach mal machen. So wie überall im ländlichen Raum kommt es auch in der Lausitz darauf an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.“ Anja ist studierte Kulturmanagerin (UNESCO Modellstudiengang, FH-Dipl.) mit einem besonderen Schwerpunkt „Schutz europäischen Kulturerbes“ (Master of Arts, Europa-Universität VIADRINA) und einem Herz für die sperrige Schönheit der Industriekultur. Als Stiftungsgründerin und Geschäftsführerin hat sie in der Praxis NGO-Management erprobt und aktiv gelebt, fachlich nachgelegt und sich beim Bundesverband Deutscher Stiftungen zur Stiftungsmanagerin qualifiziert.
Wie kommt man vom Kraftwerk zum Kochen mit regionalen Produkten? „Meine Leidenschaft für die essbaren Landschaften der Lausitz hat mich zu vielen guten Geschichten und wunderbaren Menschen geführt“, erzählt die Macherin aus dem Dreiländereck. „Interessanter Weise treffe ich bei meiner ehrenamtlichen Arbeit für Slow Food und mein Netzwerk Ein Korb voll Glück auf die gleiche intrinsische Motivation und Leidenschaft, die ich auch aus dem Ehrenamtskontext der Kulturarbeit kenne.

So liegt es nahe, sich mit den gleichen Instrumenten dem Thema zu näheren: Storytelling, Netzwerkorganisation, Forschung und praktischem Tun. Auf diesem Weg entstanden ein Blog, zahlreiche Projekte und ich dufte mich im Strukturwandel der Lausitz aktiv einbringen.“ Man sieht, die Handlungs-Instrumente ist auch mal der Kochlöffel und vor allem sind es die Feder, analog wie digital, und der aktiv geführte Dialog.
Aktuell forscht Anja Nixdorf-Munkwitz zum Thema Engagementkultur und die Bedeutung von Identitäten für Transformationsprozesse. Sie ist bei der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH tätig und wirkt dort in der „Taskforce Strukturwandel“ mit. Dem Thema Industriekultur widmet sich Anja als Vorsitzende des Landesverbandes Industriekultur Sachsen e.V.. Das die guten Dinge, die Leib und Seele zusammen halten, nicht zu kurz kommen, dafür sorgt das Herzensprojekt Ein Korb voll Glück welches durch das Programm Neulandgewinner für die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland gefördert wird.
(Neulandgewinner ist ein Förderprogramm des Thünen-Instituts für Regionalentwicklung e.V. und des Neuland gewinnen e.V. und wird gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und den ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (siehe: https://neulandgewinner.de/programm/).
***

Anmerkungen

Von KRAUTJUNKER gibt es eine Facebook-Gruppe sowie Porzellantassen. Weitere Informationen hier.
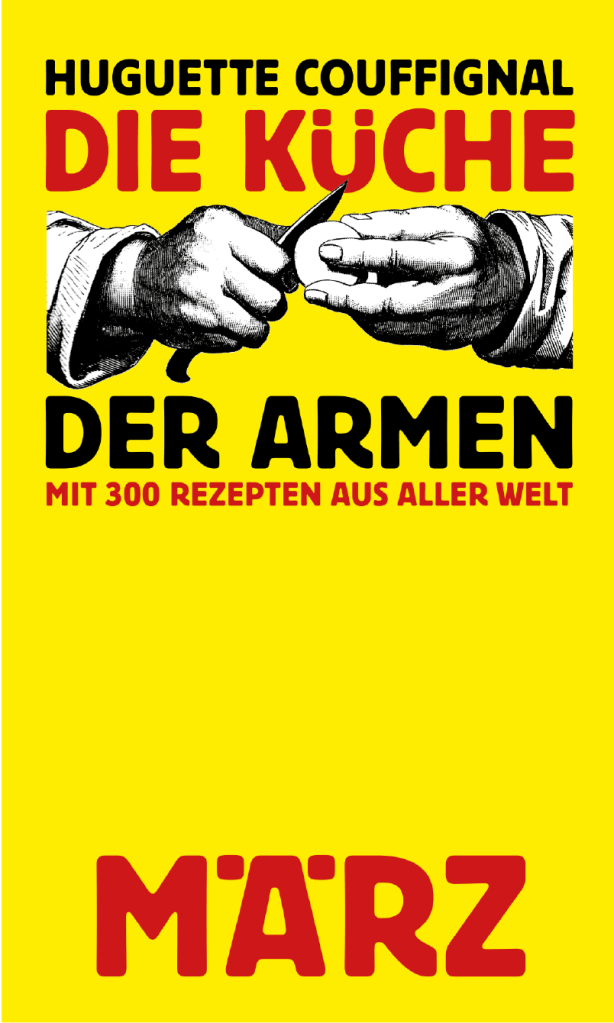
Titel: Die Küche der Armen. Mit 300 Rezepten aus aller Welt
Autorin: Huguette Couffignal
Übersetzung: Monika Junker-John und Helmut Junker
Verlag: März Verlag
Verlagslink: https://www.maerzverlag.de/shop/buecher/sachbuch/die-kueche/
ISBN: 9783755000181
Entdecke mehr von KRAUTJUNKER
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.